ITP und TTP
ITP: Immunthrombopenie
ITP ist die Kurzform für Immunthrombopenie. Die chronische Form nennt man auch Morbus Werlhof (nach dem Erstbeschreiber). Dabei liegt eine Verminderung der Blutplättchenzahl vor, die entweder durch eine verminderte Bildung oder einen vermehrten Abbau durch Antikörper bedingt ist. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung. Meistens findet man die Ursache nicht, bei ca. einem Fünftel der PatientInnen liegt eine Grunderkrankung vor.
Wir unterscheiden eine akute ITP von einer persistierenden (länger bestehenden) und einer chronischen. Die akute ITP tritt am häufigsten bei Kindern postinfektiös (meist nach einer Virus- Infektion) auf und dauert in der Regel einige Wochen bis zu 3 Monaten, gefolgt von einer spontanen Heilung.
Die chronische ITP kann über 12 Monate oder länger bestehen bleiben. Das Verhältnis von betroffenen Frauen zu Männern ist 3:1.
Die ITP ist nicht immer leicht zu diagnostizieren, da es viele verschiedene Ursachen für eine Verminderung der Blutplättchen (Thrombozyten) gibt. Dazu gehören Lebererkrankungen, angeborene Störungen, eine Pseudothrombozytopenie usw.
Leitsymptom der ITP sind pünktchenförmige, nicht wegdrückbare Blutungen (Petechien), aber auch normale blaue Flecken (Hämatome) und Blutungen im Bereich der Schleimhäute. Schwere Blutungen wie Blutungen des Magen-Darm-Traktes oder im Kopf sind zum Glück selten. Es gibt keinen festen Wert, ab dem sich diese Blutungen zeigen. Man weiß jedoch, dass das Blutungsrisiko bei einer Thrombozytenzahl von weniger als 50.000 erhöht ist und ab einer Thrombozytenzahl von weniger als 30.000 deutlich ansteigt. Auch eine verstärkte und verlängerte Menstruationsblutung kann durch eine verminderte Blutplättchenanzahl auftreten. Viele PatientInnen klagen auch über Begleitsymptome, wie z.B. starke Müdigkeit (Fatigue). Diese wird als sehr belastend empfunden.
Zur Therapie werden als Mittel der ersten Wahl Corticosteroide gegeben. Hier gibt es verschiedene Schemata. Heutzutage bevorzugen viele BehandlerInnen die kurzzeitige Gabe über einen Zeitraum von 4 Tagen. Im Notfall oder in besonderen Fällen können auch Immunglobuline über 3-5 Tage als Infusion angewandt werden.
Wichtig zu wissen ist, dass die Gabe von Cortison nicht zu lange und häufig erfolgen sollte. Zum Einsatz in der sogenannten Zweitlinie, also nach dem Corticosteroid, kommen bei Erwachsenen sowohl Thrombopoetinrezeptor-Agonisten als auch Fostamatinib (Milz-Tyrosinkinase-Inhibitor). Diese kommen meist in Tablettenform zum Einsatz, stehen aber auch als Spritze ins Unterhautfettgewebe zur Verfügung. Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihren BehandlerInnen über diese und andere Therapiemöglichkeiten beraten. Die Entfernung der Milz (Splenektomie) wird heutzutage nur noch sehr selten durchgeführt.
Sollten diese Therapien nicht anschlagen, sollten Sie die Hoffnung jedoch nicht aufgeben. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Medikamenten bzw. Medikamentenkombinationen, die zum Erfolg führen können. Und zum Glück sind einige neue Substanzen in der Forschung schon weit fortgeschritten und könnten in der Zukunft das Therapiespektrum erweitern.
Im Alltag ist es wichtig, Aspirin bzw. Acetylsalicylsäure-haltige Schmerzmittel (Achtung: häufig ist Acetylsalicylsäure in Schmerzpräparaten enthalten) zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn Sie Aspirin zur Behandlung einer Herzkrankheit benötigen. Bei sehr niedrigen Thrombozytenzahlen sollten Sie sich keine Spritzen ins Gelenk oder den Muskel verabreichen lassen.
Der Alltag mit ITP ist nicht immer leicht, trotzdem können Sie diesen aktiv gestalten. Sport und regelmäßige Bewegung sind wichtig und sinnvoll. Es gibt leider keine Diät, die die Thrombozytenzahl beeinflusst. Impfungen können und sollten nach den aktuellen Empfehlungen durchgeführt werden.
Vor Operationen gibt es bestimmte Thrombozytenschwellenwerte, die wichtig sind. Bitte klären Sie dies vor einer Operation, damit Sie ggf. vorbereitet werden können.
Ein Thema ist auch der Nachteilsausgleich. Im Einzelfall kann es für Sie sinnvoll sein, beim Versorgungsamt einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung zu stellen, um berufliche, wirtschaftliche und soziale Nachteile auszugleichen.
Zudem ist es sinnvoll, dass Sie einen Notfallausweis bei sich tragen, sich an ein auf Gerinnung spezialisiertes (Hämophilie-)Zentrum anbinden und Ihre Fragen offen mit Ihren BehandlerInnen besprechen. Es ist ratsam, sich auf die Gespräche gut vorzubereiten, damit am Ende keine wichtigen Fragen offenbleiben.
Dr. Sonia Alesci
Weitere Infos gibt es auf der Website der ITP-Allianz.
Die DHG versteht sich auch für ITP- und TTP-Patienten als Ansprechpartner und Interessenvertretung. Gerne sind wir für Euch da. Kommt zu unseren Veranstaltungen oder nehmt Kontakt auf zu unserer Geschäftsstelle, unserem Vorstand oder unseren Vertrauensmitgliedern und Jugendvertretern in den Regionen. Wir freuen uns auf Euch!
TTP: thrombotisch thrombozytopenische Purpura (Moschkowitz Syndrom)
Unter TTP versteht man die thrombotisch thrombozytopenische Purpura (Moschkowitz Syndrom). Es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung mit Fehlregulation des Abwehrsystems. Dabei werden Mikrothrombosen (kleine Gerinnsel) gebildet, die aus sehr großen von-Willebrand-Faktor Multimeren (Bestandteilen des von-Willebrand-Faktors) und Blutplättchen bestehen. Am häufigsten liegt die erworbene Form vor, die durch Antikörper gegen die von-Willebrand-Faktor spaltende Protease (ADAMTS 13) verursacht wird. Dabei unterscheidet man eine idiopathische (Ursache unbekannt) und eine sekundäre Form.
Das Krankheitsbild kann blitzartig aus völliger Gesundheit heraus auftreten. Es kommt in allen Alterstufen vor mit einem Verhältnis von Frauen zu Männern von 2:1. Es ist weniger eine seltene, als eine vielmehr zu selten diagnostizierte Erkrankung.
Auslöser für eine Manifestation oder einen Schub sind grippale und gastrointestinale Infekte, sowie Medikamente, zum Beispiel Chinin, Tiklyd oder Mitomycin.
Trotz der Therapie beträgt die Schubhäufigkeit (Häufigkeit des Wiederauftretens) circa 33% und die Letalität 10-20%.
Typisch sind folgende Symptome: Neurologische Störungen auf Grund der Mikrothrombosen im Gehirn, Blutungszeichen auf Grund der Verminderung der Bluttplättchen und eine hämolytische Anämie (Blutarmut) mit einem negativen Coombs-Test (negativer Antikörpertest gegen rote Blutkörperchen). Hinweise für die Diagnose sind die Thrombozytopenie, die LDH-Erhöhung (Laktat Dehydrogenase) und Fragmentozyten (zerstörte rote Blutkörperchen) im Blutausstrich. Beweise für die Diagnose sind die verminderte ADAMTS 13 Aktivität, der Nachweis von Antikörpern gegen ADAMTS 13 und das Vorhandensein von extrem großen von-Willebrand Multimeren.
Für die Therapie ist es sehr wichtig, dass sofort eine Plasmapherese (Blutaustausch) mit Zufuhr von FFP (fresh frozen plasma) durchgeführt wird. Eine weitere Therapiemaßnahme ist die Gabe von Rituximab, das die B-Zellen, in denen die Antikörper gebildet werden, zerstört. Die Gabe von Thrombozytenkonzentraten ist zu vermeiden.
Wir unterscheiden eine nicht rezidivierende von einer chronisch rezidivierenden Form.
Sehr selten tritt die familiäre Form auf, die durch einen Gendefekt bedingt ist.
Prof. Dr. I. Scharrer
Die DHG versteht sich auch für ITP- und TTP-Patienten als Ansprechpartner und Interessenvertretung. Gerne sind wir für Euch da. Kommt zu unseren Veranstaltungen oder nehmt Kontakt auf zu unserer Geschäftsstelle, unserem Vorstand oder unseren Vertrauensmitgliedern und Jugendvertretern in den Regionen. Wir freuen uns auf Euch!

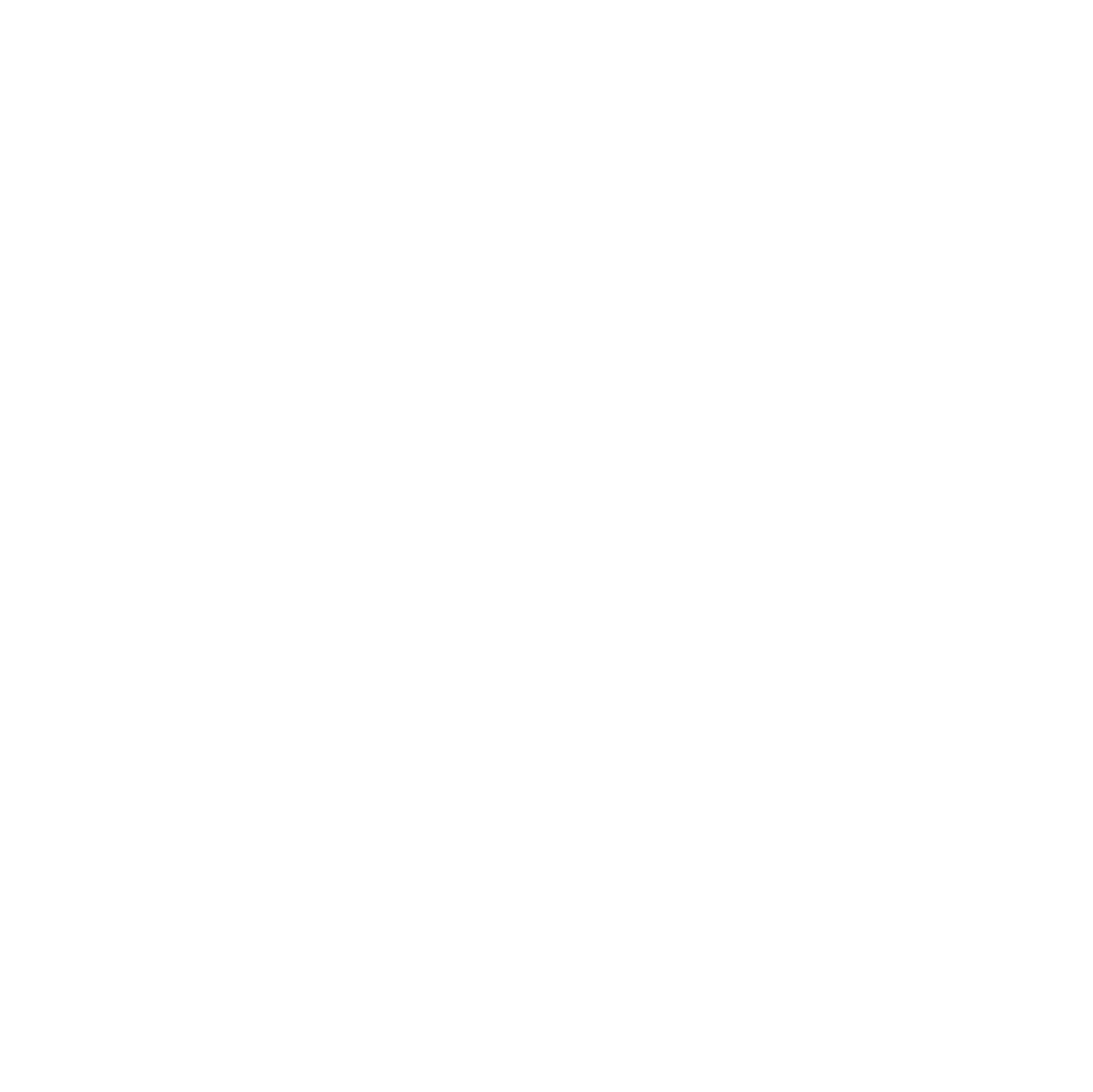

 .
.